Marburg.1.Mai2007
Hans-Ulrich Deppe
Maikundgebung des DGB am 1. Mai 2007 auf dem Marktplatz von Marburg an der Lahn
Liebe Kollegin, lieber Kollege!
Lassen wir die letzten Jahre Revue passieren: Es gibt ein Phänomen, das in unterschiedlichen Verpackungen immer wieder auftritt und gewerkschaftlichen Protest hervorruft. Das ist die Privatisierung öffentlicher Einrichtungen. Die Privatisierung öffentlicher Einrichtungen hat im letzten Jahrzehnt dramatisch zugenommen. Um nur einige aus der Vielzahl herauszugreifen, die einem spontan einfallen: die Post, die geplante Privatisierung der Bahn, kommunale Einrichtungen wie Wasser-, Elektrizitätswerke und soziale Treffpunkte, Krankenhäuser, die Rente, Universitäten oder die Studiengebühren. Unter Privatisierung versteht man die Enteignung öffentlichen Eigentums! Öffentliches Eigentum das meint Einrichtungen, die mit Steuermitteln – also kollektiven Geldern – aufgebaut und eingerichtet wurden, weil sie gesellschaftlich notwendig sind. Sie werden heute abgestoßen, weil sie unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten die Landes- oder kommunalen Haushalt belasten. Natürlich waren die Landes- und Kommunalhaushalte Jahre lang klamm. Das hat sich erst in den letzen Monaten etwas gebessert. Und wo nichts ist, da kann man auch nichts holen. Das ist zwar eine eingehende Logik – nur: Leider ist sie falsch! Denn wir dürfen bei dieser Argumentation nicht stehen bleiben und sie resignativ hinnehmen. Wir müssen vielmehr weiterfragen: Warum sind oder waren die öffentlichen Haushalte solange unterfinanziert? Und das wiederum hängt mit einer Steuerpolitik zusammen, die die Kassen der öffentlichen Haushalte bewusst leer gefegt hat. Ein Steuerpolitik, die die Unternehmen begünstigt und die Bürger belastet. In unserer Republik gibt es Großunternehmen, die heute so gut wie keine Steuern bezahlen, während die Bürger gerade eine drastische Erhöhung der Mehrwertsteuer hinnehmen mussten. Öffentliche Einrichtungen, die einst als soziale Errungenschaften galten und allen in der Gesellschaft zur Verfügung standen, werden nicht im öffentlichen Interesse saniert. Man lässt sie bewusst verkommen oder putzt sie raus, um sie unter Wettbewerbsbedingungen vermarkten und schließlich privatisieren zu können. In der Regel werden sie zu Spottpreisen verschleudert. Die verbleibenden sozialen Kosten, die in jeder Gesellschaft auftreten, werden auf die einzelnen Bürger abgewälzt. Eine solche neoliberale Politik führt zu einer Polarisierung in der Gesellschaft. Die Reichen werden reicher und die Armen werden ärmer. Und damit steigt das Konfliktpotenzial in der Gesellschaft. Das beginnt mit dem Anstieg der Kriminalität auf der Straße und in der Wirtschaft (siehe Siemens!) und geht bis zu kriegerischen Auseinandersetzungen auf globaler Ebene.
Nun – schauen wir uns hier in Marburg unter dem Gesichtspunkt der Privatisierung einmal etwas um. Da fällt einem natürlich sofort die Universität ein. Gegenwärtig werden Lehre und Forschung an den Hochschulen mittels Drittmittelforschung, Stiftungsuniversitäten und privaten Lehrstühlen, Bachelor-Studiengängen und der Einführung von Studiengebühren an den Interessen der Wirtschaft und der herrschenden Politik neu ausgerichtet. Die Kommerzialisierung von Bildung und Wissenschaft wird massiv vorangetrieben. Spielräume wissenschaftlicher Autonomie werden dramatisch verengt. Während der direkte Einfluss der Wirtschaft auf die Hochschulen mittels neuer Steuerungsinstrumente festgeklopft wird, bekommen Kooperationen mit der Zivilgesellschaft, sozialen Bewegungen und Organisationen mehr denn je Seltenheitswert. Aufklärendes Denken und kritische Wissenschaften werden an den Rand gedrängt– und in Marburg darf man noch hinzufügen: Marxistische Theorie wird langsam aber sicher ausgeschlossen!
Die Allein-Regierung der CDU in Hessen hat diese Entwicklung der Privatisierung der Hochschulen mit Macht vorangetrieben. Dabei denke ich an die in Kürze geplante Umwandlung der gesamten Frankfurter Universität in eine Stiftungsuniversität. Weiter geht es um die Einführung der Studiengebühren, die vor allem die sozial Schwachen trifft und auf den heftigen Widerstand der Studierenden gestoßen ist. Und es geht um die Privatisierung der Universitätsklinika von Gießen und Marburg, ihren Verkauf an eine private Aktiengesellschaft. Die Rhön-Klinikum AG hat am 1. Februar 2006 die volle unternehmerische Verantwortung für das Universitätsklinikum Gießen und Marburg übernommen. Hessen hat als erstes Bundesland ein Universitätsklinikum privatisiert. Die von der CDU geführte hessische Landesregierung hat damit Pilotfunktion für die gesamte Republik übernommen.
Es ist aber nicht nur das Universitätsklinikum Gießen und Marburg – auch in anderen Teilen Hessen haben wir Krankenhausprivatisierungen. Ich denke dabei an das Krankenhaus in Langen, an die Schwalm-Eder-Kliniken oder die Privatisierungsgerüchte um das Höchster Krankenhaus in Frankfurt und das Krankhaus Witzenhausen in Nordhessen.
Schauen wir uns einmal an, was die Privatisierung eines Krankenhauses nach innen bedeutet: Als erstes verändert sich das Ziel der Einrichtung. Eine öffentliche Einrichtung ist am Bedarf orientiert und darüber wird demokratisch beschlossen. Deshalb heißt es auch im Hessischen Krankenhausgesetz: „Die Gewährleistung der bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung durch leistungsfähige Krankenhäuser ist eine öffentliche Aufgaben.“(§3) Private Unternehmen haben ein anderes Ziel. Für sie hat die Rentabilität des eingesetzten Kapitals oberste Priorität. Und wie dieses Ziel erreicht werden soll, entscheiden vor allem die privaten Eigentümer. Die Aktionäre – gleich welcher Aktiengesellschaft – wollen eine satte Dividende sehen. Sie interessiert die Höhe der Dividende mehr als die Frage, wie diese zustande kommt.
Als Zweites werden Arbeitsplätze gestrichen. Immerhin betragen die Personalkosten im Krankenhaus etwa zwei Drittel der Gesamtausgaben. So heißt es hierzu in der Jahresbilanz des Deutschen Ärzteblatts zur Privatisierung des Universitätsklinikums Gießen und Marburg: „Leitende Chirurgen (müssen sich) in ´Performance-Gesprächen´ die Frage gefallen lassen, was sie eigentlich den ganzen Tag tun. Ihre Abteilungen stehen plötzlich in Konkurrenz mit (angeblich) vergleichbaren Abteilungen anderer Rhön-Kliniken … (Und) stimmt die ´Performance´ nicht, werden ärztliche Stellen gestrichen.“ Darüber hinaus beklagt das Deutsche Ärzteblatt bei seinen Recherchen eine bisher nicht bekannte Zurückhaltung der Beschäftigten gegenüber Journalisten – und meint: „Was dahinter steckt ist klar. Als börsennotiertes Unternehmen muss die Rhön-Klinikum AG darauf bedacht sein, dass keine Informationen an die Öffentlichkeit gelangen, die sich negativ auf den Aktienkurs auswirken könnten.“ (DÄ H.9, 2007, S. 453)
Das um sich greifende Rentabilitätsdenken in der Medizin führt zu einer immer stärkeren Kommerzialisierung in der Krankenversorgung. Das äußert sich darin, dass die Effizienz, die wirtschaftliche Kosten-Nutzen Relation, immer mehr in den Vordergrund geschoben wird und auf Teufel komm raus schwarze Zahlen geschrieben werden müssen. Aber die Häufigkeit und Schwere von Krankheiten richten sich leider nicht nach der jeweiligen Finanzsituation. Vom Arzt wird immer nachhaltiger eine messbare Leistung zu einem festgesetzten Preis verlangt. Diese Leistung nimmt zunehmend Merkmale einer Handelsware an, die unter Bedingungen der Konkurrenz erbracht wird. Entsprechend verwandelt sich der Patient immer mehr in einen Kunden, an dem verdient werden soll. Und der beste Kunde ist in der Regel der, an dem am meisten verdient wird. Patienten werden unter solchen Bedingungen dann vielleicht wie „König Kunde“ bedient, aber nicht mehr wie kranke Menschen behandelt.
Die zunehmende Kommerzialisierung ist freilich nicht nur ein Problem für die praktische Medizin. Auch die Forschung am Menschen ist davon betroffen. Ich denke insbesondere an die Forschung, die zunehmend über private Drittmittel finanziert wird und von den Interessen der Geldgeber keineswegs unabhängig ist. Auch hier gilt nach wie vor das Sprichwort: Wer zahlt, schafft an!
Aus dieser Problemlage ergibt sich, dass es in einer jeden Gesellschaft am Gemeinwohl orientierte Schutzzonen geben muss, die nicht der blinden Macht des Marktes und der deregulierenden Kraft der Konkurrenz überlassen werden dürfen. Es ist die oberste Aufgabe des Staates zum Schutz und zur Sicherheit seiner Bürger hier einzugreifen. Erst auf dieser Grundlage lassen sich nämlich Selbstbestimmung und eigenverantwortliches Handeln entfalten. Hier liegen die Freiheit stiftenden Effekte sozialer Sicherheit.
Kommen wir nun zur so genannten Gesundheitsreform. Nach langem Hin und Her hat die Große Koalition aus CDU und SPD ein Gesetz verabschiedet, das am 1. April dieses Jahres in Kraft getreten ist. Trotz zahlreicher Detail-Veränderungen sind die grundlegenden Probleme geblieben. Das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz trägt nicht zur Lösung der Finanzprobleme in der gesetzlichen Krankenversicherung bei. Es behebt nicht die bestehenden Gerechtigkeitsdefizite in der Finanzierung der Krankenbehandlung, sondern verschärft diese noch. Das Gesetz schont einseitig die Interessen einflussreicher Lobbygruppen. Ich denke hier besonders an die Pharmaindustrie und die privaten Krankenversicherungen. Und die finanziellen Lasten dieser Politik haben in erster Linie die Versicherten der gesetzlichen Krankenkassen zu tragen. Die Verlierer dieser Reform sind die Kassen und die Versicherten. Insgesamt fällt auf, dass auf die eigentlichen Finanzprobleme der GKV nicht eingegangen wird. Kein Wort wird darüber verloren, dass die neoliberale Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik, die stagnierenden Erwerbseinkommen und die anhaltende Massenarbeitslosigkeit den Umfang sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung eingedampft haben. Wie wichtig dieser Punkt ist, können wir daran sehen, dass öffentliche Haushalte und gesetzliche Krankenversicherungen schnell wieder liquide werden, wenn die Arbeitslosigkeit – wie in den letzten Monaten – nur geringfügig zurückgeht und sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze entstehen. Eine vernünftige Arbeitsmarktpolitik ist also die beste Finanzierungsgrundlage für die GKV. Solange hier keine grundsätzliche Umorientierung stattfindet und die neoliberalen Bedingungen auch weiterhin als unveränderlich akzeptiert werden, ist die nächste Finanzierungskrise der Krankenversorgung vorprogrammiert.
Immer wieder können wir hören, dass die Entwicklung schon weit fortgeschritten sei und dass es dagegen kein Heilmittel gebe. Es handele sich sozusagen um einen Sachzwang, dem man sich beugen müsse. Ohne den zweifellos entstandenen Druck bagatellisieren zu wollen, meine ich aber, dass dieser von Menschen erzeugte Druck auch von Menschen verändert werden kann. Schließlich sind ökonomische Modelle menschliche Konstrukte und keine Naturgesetze.
Kerngedanke eines anderen, gegen die zerstörerische Kommerzialisierung gerichteten Modells ist die Solidarität. Denn Solidarität geht nicht von den Individuen und ihren marktvermittelten Beziehungen aus. Sie beruht vielmehr auf Gemeinsamkeit und Fairness. Solidarität setzt ein Bewusstsein von Gemeinsamkeit und innerer Verbundenheit voraus, das in einer Kultur, einer ethnischen Gruppe oder in einer sozialen Lage mit spezifischen Lebenserfahrungen begründet ist. Wie wir aus der Geschichte wissen, kann Solidarität große Probleme wie Arbeitslosigkeit, Armut oder Rechtlosigkeit bewältigen. Am wirkungsvollsten kommt Solidarität in organisierter Form mit breiter Beteiligung von unten zur Geltung. Und im Gesundheitswesen sind in der Tat gemeinsame Anstrengungen zur Lösung eines gemeinsamen Problems gefragt.
In vielen Ländern zählt gerade die Krankenversorgung zu dem Bereich, in dem Solidarität ein traditionelles Strukturprinzip ist. Sie kommt hier in unterschiedlichen Formen wie Hilfsbereitschaft, Caritas, Diakonie oder Gegenseitigkeit zum Ausdruck. Krankheit ist nämlich ein allgemeines Lebensrisiko, von dem alle betroffen werden können. Und in der Stunde der Not sind Kranke auf Solidarität angewiesen. Auch im deutschen Gesundheitssystem hat Solidarität einen hohen Stellenwert. Es besagt, dass bis zu einer festgelegten Einkommensgrenze Sozialversicherte mit unterschiedlichen Beiträgen einen Anspruch auf gleiche Leistungen im Krankheitsfall haben und dass bestimmte Gesellschaftsgruppen wie Kinder oder nicht berufstätige Ehepartner ohne eigene Beiträge mitversichert sind. Auch die Mitfinanzierung der Krankenversicherung von Rentnern und Arbeitslosen durch versicherungspflichtige Beschäftigte ist in einem erweiterten Sinn der Solidarität zuzurechnen.
Diese Solidarität im Gesundheitswesen ließe sich durch eine Bürgerversicherung ausweiten. Stattdessen wird sie durch den Einsatz neoliberaler Instrumente systematisch zerstört. Bedauernswert ist, dass inzwischen selbst politische Organisationen, die einst ihre Identität aus der Kraft der Solidarität schöpften, sich heute diesem Prozess nicht nur nicht widersetzen, sondern ihn sogar noch unterstützen.
Solidarische Alternativen sind möglich! Im Gesundheitswesen wird dabei an folgende Grundsätze gedacht:
– Die Krankenversorgung ist alleine am medizinischen Bedarf auszurichten.
– Die gesamte Bevölkerung hat freien Zugang zur Krankenversorgung.
– Die medizinischen Leistungen sind für alle gleich, unabhängig von den individuellen finanziellen Möglichkeiten.
– Die Finanzierung erfolgt solidarisch in Form von Steuern oder Beiträgen.
– Gesundheitsförderung hat einen erheblichen Nachholbedarf gegenüber der Krankenversorgung.
Diese Eckpunkte richten sich gegen die Unterwerfung der Krankenversorgung unter die kommerziellen Gesetze des globalen Marktes. Sie stehen für eine Absicherung des sozialen Risikos Krankheit durch die solidarische Bereitstellung öffentlicher Güter. Sie demonstrieren, dass das Prinzip der Solidarität als Alternative zur Privatisierung und Kommerzialisierung der Krankenversorgung möglich ist. Deshalb lohnt es sich auch, für ihren weiteren Ausbau zu kämpfen. Und das gilt nicht nur für die Krankenversorgung, sondern für eine humane Gesellschaft insgesamt, in der soziale Gerechtigkeit und gute Arbeit respektiert werden (Motto).

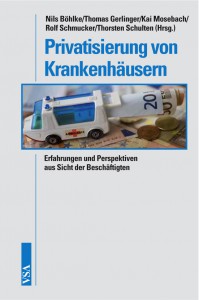


 Derzeit gehen die beiden privaten Klinikketten
Derzeit gehen die beiden privaten Klinikketten  Die Privatisierungswelle bei deutschen Krankenhäusern wird sich 2006 beschleunigen. Wegen des wachsenden Kostendrucks können Städte und Landkreise die oftmals defizitären Kliniken nicht mehr finanzieren, das Geld für notwendige Investitionen fehlt. Die Folge: Öffentlich-rechtliche Krankenhäuser werden geschlossen oder an private Betreiber verkauft. Verbraucherschützer befürchten dadurch freilich eine Verschlechterung der Patientenversorgung. Der Verkauf der Universitätsklinik Gießen-Marburg an den börsennotierten Krankenhausbetreiber Rhön-Klinikum – die erste Privatisierung einer Uniklinik in der Europäischen Union – dürfte erst der Anfang gewesen sein. „In den nächsten zwei bis drei Jahren werden wir verstärkt sehen, dass Krankenhäuser übernommen werden“, sagt Analyst Volker Braun vom Broker Equinet. „Wir haben einen sehr starken Trend in Richtung Privatisierung. Das wird sich 2006 bestätigen“, sagt Christian Cohrs von der HVB. Dabei entdecken mehr und mehr Unternehmen die Branche als attraktiv: Der
Die Privatisierungswelle bei deutschen Krankenhäusern wird sich 2006 beschleunigen. Wegen des wachsenden Kostendrucks können Städte und Landkreise die oftmals defizitären Kliniken nicht mehr finanzieren, das Geld für notwendige Investitionen fehlt. Die Folge: Öffentlich-rechtliche Krankenhäuser werden geschlossen oder an private Betreiber verkauft. Verbraucherschützer befürchten dadurch freilich eine Verschlechterung der Patientenversorgung. Der Verkauf der Universitätsklinik Gießen-Marburg an den börsennotierten Krankenhausbetreiber Rhön-Klinikum – die erste Privatisierung einer Uniklinik in der Europäischen Union – dürfte erst der Anfang gewesen sein. „In den nächsten zwei bis drei Jahren werden wir verstärkt sehen, dass Krankenhäuser übernommen werden“, sagt Analyst Volker Braun vom Broker Equinet. „Wir haben einen sehr starken Trend in Richtung Privatisierung. Das wird sich 2006 bestätigen“, sagt Christian Cohrs von der HVB. Dabei entdecken mehr und mehr Unternehmen die Branche als attraktiv: Der